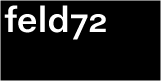“Zwei Dinge bedrohen beständig die Welt, die Ordnung und die Unordnung.” (Paul Valery)
Vater: Wenn dein Malkasten da steht, wo er hingehört, wo ist er dann?
Tochter: Hier am Rand dieses Regals.
Vater: Na gut, und was ist, wenn er irgendwo anders steht?
Tochter:Nein, das wäre unordentlich.
Vater: Was ist mit der anderen Seite des Regals, hier? So etwa?
Tochter: Nein, da gehört er nicht hin, und überhaupt müsste er gerade stehen, nicht so schief,wie du ihn hingestellt hast.
Vater: Oh an der richtigen Stelle und gerade.
Tochter: Ja.
Vater: Das heißt also, dass es nur sehr wenige Stellen gibt, die für deinen Malkasten “ordentlich” sind, aber unendlich viele, die du “unordentlich” nennst.
(Gregory Bateson, in “Ökologie des Geistes”)
Prämisse:
Meine Ordnung ist tendenziell immer auch die Unordnung der anderen.
Die Dinge sind in konstanter Tendenz zur Unordnung.
Die Unordnung, welche physikalisch durch die Entropie beschrieben wird, fängt also nicht nur erst im Kinderzimmer an, sondern nimmt im Universum insgesamt immer weiter zu und hört im Wärmetod desselben auf. Wie uns die Astrophysiker bestätigen, gibt es aber immer wieder in lokalen Bereichen Ordnung, Struktur und Komplexität, wie z.B. Sterne, Planeten und Leben. Diese Zustände sind gekennzeichnet durch niedrige Entropie oder großer Ordnung und Komplexität. Das geht jedoch nur auf Kosten der Umgebung oder Umwelt, die den ausgesandten überschüssigen Entropiemüll von solchen geordneten, strukturierten und komplexen Gebilden schlucken muss. Lässt sich dieses Modell auch auf unsere Städte anwenden?
„Der „Ort“ ist nicht tot zu kriegen.“
Das war das erste, das ich dachte am Weg zum Genochmarkt in Kagran. Wie dem „Autor“ schien dem „Ort“ dasselbe Schicksal bestimmt zu sein: philosophisch betrachtet eine Illusion, eine Chimäre, und doch unumstösslich immer wieder hier, als Grundlage erst einer möglichen Dekonstruktion. Die Wittgensteinsche Leiter. Der Ast, auf dem sitzend man zu sägen beginnt.
Orte. Unorte. Ordnung. Unordnungen.
Unortnung.
Das Gefühl, in der Peripherie zu sein, beginnt in Wien dort, wo eigentlich erst sein geografisches Zentrum liegt. Ich musste die Türme der Donauplatte stadtauswärts (der momentanen Bautätigkeit und Kubikmeterproduktion nach müsste man eigentlich „stadteinwärts“ sagen) weit hinter mir liegen lassen, um unerwartet auf den nur für diese Nacht hoch frequentierten stillgelegten Markt zu kommen. Die „Nicht‐Orte“, die mir auf dem Weg dorthin begegneten, sind seit Marc Auges Betrachtungen längst schon zum Sujet von Fototapeten geworden. Mehr als ein Jahrzehnt des Abarbeitens der Fotokunst am Thema hat die „Unorte“ zu „Orten“ werden lassen, Räume, die wir klischeebedingt mit Bedeutungen füllen und in jedem Kriminalfilm und Sozialrealismusporno wie ein Setting auf Abruf funktionieren, das mit dem Bild automatisch auf soziale Konstellationen in diesen Räumen verweist. Das Transformationsmonster Mensch hat sogar in den Nicht‐Orten die begehrenswerte und wenn möglich reproduzierbare Coolness gefunden.
Auf der Einladungskarte war der Genochmarkt nur einer von mehrern weißen (Interventions)Punkten auf einem roten Feld. Punkte in einem imaginären Kraftfeld, welches wir Stadt zu nennen gewohnt sind. Die Einladungskarte schien mehr ein Rorschachtest denn ein Wegweiser zu sein, und doch schien sie exakt das Dilemma der Urbanisten wiederzuspiegel: Im zenithalen Blick alleine bleibt uns das Etwas, das wir vormals Stadt genannt haben, verborgen. Wir legen uns Erklärungen zum Entziffern der vorgefundenen Muster im Meer der totalen Urbanisierung zurecht, die mehr über uns aussagen als über das, was wir wirklich vor den „Augen“ haben. Konstruktionen von Konstruktionen von Ordnungssystemen. Um zu verstehen und begreifen, müssen wir Hände und Beine gebrauchen, und uns einlassen ins „Labyrinth der Welt“, ohne uns von den Tricks von Daidolos in die Irre führen zu lassen, von denen uns Michel de Certeau in seiner „Kunst des Handelns“ und „Erfindung des Alltags“ warnt.*
Hier fängt „Unortnung“ an.
„Unortnung“ ist eine Serie von Raumbesetzungen und Umkehrungen als Resultat einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Raumes bzw. des Ortes unter Auferlegung bestimmter klarer Spielregeln an die Akteure. Das, was Veronika Barnas (am Anfang noch mit Andrea Maria Krenn) mit ihrer Reihe der „Unortnungen“ initiert hat, hat ein Naheverhältnis zu bestimmten Phänomenen in der zeitgenössischen Architektur, aber wie das Wort schon sagt, handelt es sich nicht um eine Einheit und folglich „um ein und dasselbe“, sondern um eine Beziehung zwischen nicht gleichwertigen Elementen (Naheverhältnisse zwischen eineiigen Zwillingen ausgenommen). Neue Zwischenfelder haben sich aufgetan, und neue Protagonisten an den Schnittstellen von Architektur, Urbanismus, Kunst , Design und Stadtsoziologie begannen ihre Suche nach neuen Antworten auf die Bedingungen der Transformationsprozesse des (r)urbanen Raumes. Strategien zur Zwischennutzung, prozess‐orientierte Planungen mit Bezug auf soziale Nachhaltigkeit, temporäre Architekturen und situationsspezische performative Werkzeuge für den öffentlichen Raum waren und sind die Folge. Wobei diese Phänomene, auf welche man zu reagieren versucht, weder neu noch spezifisch für unsere Breitenkreise sind. Allein in der Stadtgeschichte der Ewigen Stadt Rom ist das meiste davon schon erzählt worden: Tabula Rasa, rapides Wachstum, Umnutzungen, Weiterstricken, radikale Brüche, Hybride von Architektur und Landschaft, ja sogar Schrumpfung, denn was anderers als eine super‐shrinking city war das Rom des Jahres 1000, als nur mehr 20‐30.000 Einwohner sich in einer Stadtstruktur widerfanden, die einst für mehr als 1,5 Millionen Menschen als Lebensraum gebaut worden war? Die Ordnung der Natur ist eine andere als die Konstruktion der Menschen. So bekam der Begriff des Urbanen Dschungels in jener Zeit in Rom eine wortwörtliche Bedeutung. Die Haltbarkeit unserer Baustoffe diktiert die Möglichkeiten unserer zukünftigen räumlichen Erinnerungen, und so finden wir Raumsysteme der Vergangenheit vor, bei denen die unwichtigsten Elemente das einzige sind, was uns erhalten geblieben ist. Das Paradox unserer Kultur der digitalen Ordnungssysteme und unendlich scheinenden Speicherleistungen bleibt, dass ‐ nach dem all unsere Städte zerfallen sein werden ‐ nicht diese unsere Weltmeister‐des‐Erinnerns‐Kultur definierenden Produkte, sondern nur unsere Plastiktaschen und Kochtöpfe aus speziellen Stahllegierungen zukünftigen Archäologen in die Hände fallen werden. Zerfall und Zufall liegen oft eng beieinander. Eine programmierte Ruinenästhetik als eine in der Vision des Bauens schon eingeschriebene Option konnte nur in einem Zeitalter des Bewusstseins der totalen Zerstörung wie dem letzten Jahrhundert ihren perversen und nekrophilen Höhepunkt finden (siehe Albert Speer), der Umgang in Rom mit dem Bestand war bis zur Erfindung des Denkmalschutzes ein viel pragmatischer.
Phänomenologisch betrachtet nichts Neues unter der Sonne? Speed changes everything. In einem Zeitalter der rasanten Beschleunigung erfahren wir eine Parallelität dieser Prozesse und eine schwinderlerregende Abfolge gegensätzlicher Phänomene, und als Resultat des High‐Speed‐Urbanismus Chinas fanden sich die vormals 30.000 Einwohner Shenzhens des Jahres 1980 ohne Ortswechsel nur drei Jahrzehnte später mit 14 Millionen Mitbürgern in einer Stadt mit denselben Namen wieder. Gentrifizierung ist in unseren Kulturstädten zu einem Allerweltswort geworden ( zwar noch mit mehr als 4 Buchstaben geschrieben), und der Coolness‐Faktor von Stadtvierteln wechselt sich in den selben Zyklen wie die Modeindustrie ihre Farben. Vormalige Industriestandpunkte im Osten Deutschlands promoten sich als billiges Rentnerparadies, um ihres Leerstandes Herr zu werden, und Wien, das für beinahe 50 Jahre am räumlichen Abstellgleis der Geschichte von Eisernen Vorhängen eingekesselt und zum reinen Veraltern verdammt schien, ja, dieses Wien wächst. Im Jahre 2050 wird die Stadt wieder der Einwohnerzahl nahe kommen, die sie bereits von 100 Jahren in einer bedeutend kleineren Stadtstruktur hatte: 2 Millionen. Diese Transformationsprozesse schaffen Übergangszeiten und Nischen, Restposten, Altlasten und folglich kleine Löcher im System der ökonomischen Verwertbarkeit. Und in diesen räumlichen Lücken entsteht manchmal so etwas wie der Hauch von „Freiheit“, zwar zunächst nur als Absenz einer übergeordenten Überwachung als Folge von okonomisch‐sozialem Desinteresse, also „Freiheit von …“. „Unortnung“ versuchte nun, diese zu einer “Freiheit zu…“ wachsen zu lassen.
Der Ort und der Raum wurden zum Ausgangspunkt der künstlerischen Intervention. Die Kurzlebigkeit wurde zur Prämisse, und wiewohl wir wissen, dass man auch im Temporären ewig „hausen“ kann, sind die Arbeiten nur noch in unseren Erinnerungen und unseren diesbezüglichen technischen Hilfsmitteln präsent. Ort und Raum. Topos und chora, wie sie in der antiken Philosophie bezeichnet wurden. Topos, der laut Aristoteles von einem begrenzten Körper besetzte oder eingenommene Raum, folglich “Ort” genannt, und chora, der Raum, der viele solcher Räume beinhaltet. Die Suche nach dem Ort als Bedeutungsmuster innerhalb des seit der Moderne nur als drei‐, bestenfalls vierdimensional wahrgenommen Raumes ist in der Architekturdiskussion spätestens von historisch als „postmodern“ zu bezeichneten Theoretikern und Architekten das erste Mal wieder aufgegriffen worden – mit dem Verweis auf den „genius loci“ der Römer konnte Christian Norberg‐Schulz wieder einen Jahrtausende alten Begriff in die damalige Aktualität bringen. Wim Wenders und Michelangelo Antonioni haben dem Spezifischen des Begriffs, also den jeweiligen Orten als Generatoren von Geschichten (und laut ihrer Raumphilosophie: nicht umgekehrt) filmische Denkmäler gesetzt, und spätestens nach Marc Auge war das Wort „Ort “ nicht mehr nur in Heimatbundtreffen zu Hause. Das Herstellen von Bedeutung innerhalb des Raumes ist keine Banalität, und die Frage danach hat sich nicht erst seit dem ersten Schichten von Steinen zu einem Kultplatz oder dem Vergraben eines Kriegsbeils tief in unsere jeweilige Kultur eingeschrieben.
„Unortnung“ versucht das Selbe. Der Logik des Raumes auf die Spur zu kommen, und sie beizeiten auch zu überlisten. Durch die Absurdität der Kurzlebigkeit dieser im besten Falle „Orte“ haben wir es natürlich weniger mit einer auf Permanenz basierenden Untersuchung und einem Weiterstricken einer vorhandenen Ordnung zu tun, als mehr mit einem situationistischen „Ereignis“. Zum räumlichen Loch gesellt sich das zeitliche.
Eine temporäre Zone, nicht autonom wie bei Hakim Bey, doch dennoch ein Versuch einer Umordnung, und eines raumlich‐künstlerischen als auch (weniger als Ausgangspunkt denn als Resultat) sozialen Experiments. Das Vorgefundene wurde interpretiert, konstatiert, negiert, absorbiert und weiter konstruiert im Bewusstsein eines klar definierten Halbwertsdatum. Die Tatsache, das für diese kurze Zeit in diesen nicht genutzten Räumen mehr Aufwand an der Konstruktion von Bedeutung betrieben wurde als in der alltäglichen physischen Produktion von (Lebens)Raum, sollte uns zu denken geben. Dass das Buch, welches Sie in den Händen halten, eines der wenigen Artefakte ist, welches dieser Bedeutung jetzt noch als Erinnerungsträger Raum geben kann, natürlich ebenfalls.
„I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tanhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.“
(Roy Batty in „Bladerunner“ von Ridley Scott)
*siehe auch: Michael Obrist, „Von den Augen der Götter und dem Irren der Menschen. Raumphänomene in den Zeiten von Google Earth“ in „food&grid. raum&designstrategien“, (Hg. Elsa Prochazka).
Text
Michael Obrist
In:
UnORTnung. Eine Ausstellungsreihe in Wien
(Hsgr. Veronika Barnas)
Schleebrügge Editor, 2011
“Zwei Dinge bedrohen beständig die Welt, die Ordnung und die Unordnung.” (Paul Valery)
Vater: Wenn dein Malkasten da steht, wo er hingehört, wo ist er dann?
Tochter: Hier am Rand dieses Regals.
Vater: Na gut, und was ist, wenn er irgendwo anders steht?
Tochter:Nein, das wäre unordentlich.
Vater: Was ist mit der anderen Seite des Regals, hier? So etwa?
Tochter: Nein, da gehört er nicht hin, und überhaupt müsste er gerade stehen, nicht so schief,wie du ihn hingestellt hast.
Vater: Oh an der richtigen Stelle und gerade.
Tochter: Ja.
Vater: Das heißt also, dass es nur sehr wenige Stellen gibt, die für deinen Malkasten “ordentlich” sind, aber unendlich viele, die du “unordentlich” nennst.
(Gregory Bateson, in “Ökologie des Geistes”)
Prämisse:
Meine Ordnung ist tendenziell immer auch die Unordnung der anderen.
Die Dinge sind in konstanter Tendenz zur Unordnung.
Die Unordnung, welche physikalisch durch die Entropie beschrieben wird, fängt also nicht nur erst im Kinderzimmer an, sondern nimmt im Universum insgesamt immer weiter zu und hört im Wärmetod desselben auf. Wie uns die Astrophysiker bestätigen, gibt es aber immer wieder in lokalen Bereichen Ordnung, Struktur und Komplexität, wie z.B. Sterne, Planeten und Leben. Diese Zustände sind gekennzeichnet durch niedrige Entropie oder großer Ordnung und Komplexität. Das geht jedoch nur auf Kosten der Umgebung oder Umwelt, die den ausgesandten überschüssigen Entropiemüll von solchen geordneten, strukturierten und komplexen Gebilden schlucken muss. Lässt sich dieses Modell auch auf unsere Städte anwenden?
„Der „Ort“ ist nicht tot zu kriegen.“
Das war das erste, das ich dachte am Weg zum Genochmarkt in Kagran. Wie dem „Autor“ schien dem „Ort“ dasselbe Schicksal bestimmt zu sein: philosophisch betrachtet eine Illusion, eine Chimäre, und doch unumstösslich immer wieder hier, als Grundlage erst einer möglichen Dekonstruktion. Die Wittgensteinsche Leiter. Der Ast, auf dem sitzend man zu sägen beginnt.
Orte. Unorte. Ordnung. Unordnungen.
Unortnung.
Das Gefühl, in der Peripherie zu sein, beginnt in Wien dort, wo eigentlich erst sein geografisches Zentrum liegt. Ich musste die Türme der Donauplatte stadtauswärts (der momentanen Bautätigkeit und Kubikmeterproduktion nach müsste man eigentlich „stadteinwärts“ sagen) weit hinter mir liegen lassen, um unerwartet auf den nur für diese Nacht hoch frequentierten stillgelegten Markt zu kommen. Die „Nicht‐Orte“, die mir auf dem Weg dorthin begegneten, sind seit Marc Auges Betrachtungen längst schon zum Sujet von Fototapeten geworden. Mehr als ein Jahrzehnt des Abarbeitens der Fotokunst am Thema hat die „Unorte“ zu „Orten“ werden lassen, Räume, die wir klischeebedingt mit Bedeutungen füllen und in jedem Kriminalfilm und Sozialrealismusporno wie ein Setting auf Abruf funktionieren, das mit dem Bild automatisch auf soziale Konstellationen in diesen Räumen verweist. Das Transformationsmonster Mensch hat sogar in den Nicht‐Orten die begehrenswerte und wenn möglich reproduzierbare Coolness gefunden.
Auf der Einladungskarte war der Genochmarkt nur einer von mehrern weißen (Interventions)Punkten auf einem roten Feld. Punkte in einem imaginären Kraftfeld, welches wir Stadt zu nennen gewohnt sind. Die Einladungskarte schien mehr ein Rorschachtest denn ein Wegweiser zu sein, und doch schien sie exakt das Dilemma der Urbanisten wiederzuspiegel: Im zenithalen Blick alleine bleibt uns das Etwas, das wir vormals Stadt genannt haben, verborgen. Wir legen uns Erklärungen zum Entziffern der vorgefundenen Muster im Meer der totalen Urbanisierung zurecht, die mehr über uns aussagen als über das, was wir wirklich vor den „Augen“ haben. Konstruktionen von Konstruktionen von Ordnungssystemen. Um zu verstehen und begreifen, müssen wir Hände und Beine gebrauchen, und uns einlassen ins „Labyrinth der Welt“, ohne uns von den Tricks von Daidolos in die Irre führen zu lassen, von denen uns Michel de Certeau in seiner „Kunst des Handelns“ und „Erfindung des Alltags“ warnt.*
Hier fängt „Unortnung“ an.
„Unortnung“ ist eine Serie von Raumbesetzungen und Umkehrungen als Resultat einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Raumes bzw. des Ortes unter Auferlegung bestimmter klarer Spielregeln an die Akteure. Das, was Veronika Barnas (am Anfang noch mit Andrea Maria Krenn) mit ihrer Reihe der „Unortnungen“ initiert hat, hat ein Naheverhältnis zu bestimmten Phänomenen in der zeitgenössischen Architektur, aber wie das Wort schon sagt, handelt es sich nicht um eine Einheit und folglich „um ein und dasselbe“, sondern um eine Beziehung zwischen nicht gleichwertigen Elementen (Naheverhältnisse zwischen eineiigen Zwillingen ausgenommen). Neue Zwischenfelder haben sich aufgetan, und neue Protagonisten an den Schnittstellen von Architektur, Urbanismus, Kunst , Design und Stadtsoziologie begannen ihre Suche nach neuen Antworten auf die Bedingungen der Transformationsprozesse des (r)urbanen Raumes. Strategien zur Zwischennutzung, prozess‐orientierte Planungen mit Bezug auf soziale Nachhaltigkeit, temporäre Architekturen und situationsspezische performative Werkzeuge für den öffentlichen Raum waren und sind die Folge. Wobei diese Phänomene, auf welche man zu reagieren versucht, weder neu noch spezifisch für unsere Breitenkreise sind. Allein in der Stadtgeschichte der Ewigen Stadt Rom ist das meiste davon schon erzählt worden: Tabula Rasa, rapides Wachstum, Umnutzungen, Weiterstricken, radikale Brüche, Hybride von Architektur und Landschaft, ja sogar Schrumpfung, denn was anderers als eine super‐shrinking city war das Rom des Jahres 1000, als nur mehr 20‐30.000 Einwohner sich in einer Stadtstruktur widerfanden, die einst für mehr als 1,5 Millionen Menschen als Lebensraum gebaut worden war? Die Ordnung der Natur ist eine andere als die Konstruktion der Menschen. So bekam der Begriff des Urbanen Dschungels in jener Zeit in Rom eine wortwörtliche Bedeutung. Die Haltbarkeit unserer Baustoffe diktiert die Möglichkeiten unserer zukünftigen räumlichen Erinnerungen, und so finden wir Raumsysteme der Vergangenheit vor, bei denen die unwichtigsten Elemente das einzige sind, was uns erhalten geblieben ist. Das Paradox unserer Kultur der digitalen Ordnungssysteme und unendlich scheinenden Speicherleistungen bleibt, dass ‐ nach dem all unsere Städte zerfallen sein werden ‐ nicht diese unsere Weltmeister‐des‐Erinnerns‐Kultur definierenden Produkte, sondern nur unsere Plastiktaschen und Kochtöpfe aus speziellen Stahllegierungen zukünftigen Archäologen in die Hände fallen werden. Zerfall und Zufall liegen oft eng beieinander. Eine programmierte Ruinenästhetik als eine in der Vision des Bauens schon eingeschriebene Option konnte nur in einem Zeitalter des Bewusstseins der totalen Zerstörung wie dem letzten Jahrhundert ihren perversen und nekrophilen Höhepunkt finden (siehe Albert Speer), der Umgang in Rom mit dem Bestand war bis zur Erfindung des Denkmalschutzes ein viel pragmatischer.
Phänomenologisch betrachtet nichts Neues unter der Sonne? Speed changes everything. In einem Zeitalter der rasanten Beschleunigung erfahren wir eine Parallelität dieser Prozesse und eine schwinderlerregende Abfolge gegensätzlicher Phänomene, und als Resultat des High‐Speed‐Urbanismus Chinas fanden sich die vormals 30.000 Einwohner Shenzhens des Jahres 1980 ohne Ortswechsel nur drei Jahrzehnte später mit 14 Millionen Mitbürgern in einer Stadt mit denselben Namen wieder. Gentrifizierung ist in unseren Kulturstädten zu einem Allerweltswort geworden ( zwar noch mit mehr als 4 Buchstaben geschrieben), und der Coolness‐Faktor von Stadtvierteln wechselt sich in den selben Zyklen wie die Modeindustrie ihre Farben. Vormalige Industriestandpunkte im Osten Deutschlands promoten sich als billiges Rentnerparadies, um ihres Leerstandes Herr zu werden, und Wien, das für beinahe 50 Jahre am räumlichen Abstellgleis der Geschichte von Eisernen Vorhängen eingekesselt und zum reinen Veraltern verdammt schien, ja, dieses Wien wächst. Im Jahre 2050 wird die Stadt wieder der Einwohnerzahl nahe kommen, die sie bereits von 100 Jahren in einer bedeutend kleineren Stadtstruktur hatte: 2 Millionen. Diese Transformationsprozesse schaffen Übergangszeiten und Nischen, Restposten, Altlasten und folglich kleine Löcher im System der ökonomischen Verwertbarkeit. Und in diesen räumlichen Lücken entsteht manchmal so etwas wie der Hauch von „Freiheit“, zwar zunächst nur als Absenz einer übergeordenten Überwachung als Folge von okonomisch‐sozialem Desinteresse, also „Freiheit von …“. „Unortnung“ versuchte nun, diese zu einer “Freiheit zu…“ wachsen zu lassen.
Der Ort und der Raum wurden zum Ausgangspunkt der künstlerischen Intervention. Die Kurzlebigkeit wurde zur Prämisse, und wiewohl wir wissen, dass man auch im Temporären ewig „hausen“ kann, sind die Arbeiten nur noch in unseren Erinnerungen und unseren diesbezüglichen technischen Hilfsmitteln präsent. Ort und Raum. Topos und chora, wie sie in der antiken Philosophie bezeichnet wurden. Topos, der laut Aristoteles von einem begrenzten Körper besetzte oder eingenommene Raum, folglich “Ort” genannt, und chora, der Raum, der viele solcher Räume beinhaltet. Die Suche nach dem Ort als Bedeutungsmuster innerhalb des seit der Moderne nur als drei‐, bestenfalls vierdimensional wahrgenommen Raumes ist in der Architekturdiskussion spätestens von historisch als „postmodern“ zu bezeichneten Theoretikern und Architekten das erste Mal wieder aufgegriffen worden – mit dem Verweis auf den „genius loci“ der Römer konnte Christian Norberg‐Schulz wieder einen Jahrtausende alten Begriff in die damalige Aktualität bringen. Wim Wenders und Michelangelo Antonioni haben dem Spezifischen des Begriffs, also den jeweiligen Orten als Generatoren von Geschichten (und laut ihrer Raumphilosophie: nicht umgekehrt) filmische Denkmäler gesetzt, und spätestens nach Marc Auge war das Wort „Ort “ nicht mehr nur in Heimatbundtreffen zu Hause. Das Herstellen von Bedeutung innerhalb des Raumes ist keine Banalität, und die Frage danach hat sich nicht erst seit dem ersten Schichten von Steinen zu einem Kultplatz oder dem Vergraben eines Kriegsbeils tief in unsere jeweilige Kultur eingeschrieben.
„Unortnung“ versucht das Selbe. Der Logik des Raumes auf die Spur zu kommen, und sie beizeiten auch zu überlisten. Durch die Absurdität der Kurzlebigkeit dieser im besten Falle „Orte“ haben wir es natürlich weniger mit einer auf Permanenz basierenden Untersuchung und einem Weiterstricken einer vorhandenen Ordnung zu tun, als mehr mit einem situationistischen „Ereignis“. Zum räumlichen Loch gesellt sich das zeitliche.
Eine temporäre Zone, nicht autonom wie bei Hakim Bey, doch dennoch ein Versuch einer Umordnung, und eines raumlich‐künstlerischen als auch (weniger als Ausgangspunkt denn als Resultat) sozialen Experiments. Das Vorgefundene wurde interpretiert, konstatiert, negiert, absorbiert und weiter konstruiert im Bewusstsein eines klar definierten Halbwertsdatum. Die Tatsache, das für diese kurze Zeit in diesen nicht genutzten Räumen mehr Aufwand an der Konstruktion von Bedeutung betrieben wurde als in der alltäglichen physischen Produktion von (Lebens)Raum, sollte uns zu denken geben. Dass das Buch, welches Sie in den Händen halten, eines der wenigen Artefakte ist, welches dieser Bedeutung jetzt noch als Erinnerungsträger Raum geben kann, natürlich ebenfalls.
„I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tanhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.“
(Roy Batty in „Bladerunner“ von Ridley Scott)
*siehe auch: Michael Obrist, „Von den Augen der Götter und dem Irren der Menschen. Raumphänomene in den Zeiten von Google Earth“ in „food&grid. raum&designstrategien“, (Hg. Elsa Prochazka).
Text
Michael Obrist
In:
UnORTnung. Eine Ausstellungsreihe in Wien
(Hsgr. Veronika Barnas)
Schleebrügge Editor, 2011
Als Steward Brand, der später als Initiator und Herausgeber des „Whole Earth Catalogue“ nicht nur in der amerikanischen Gegenkultur zu großer Berühmtheit gelangte (Steve Jobs bezeichnete den Katalog als „Bibel seiner Generation“ und Vorläufer von Google im Paperback-Format), im Jahre 1966 Ansteck-Buttons mit der Aufschrift: „Why haven‘t we seen a photograph of the whole Earth yet?!“ produzierte und neben dem Verkauf derselben auch einen Teil davon an die Senatoren und wichtigsten Institutionen Amerikas und der damaligen Sowjetunion schickte, hatte er nichts geringeres als den Versuch einer globalen Bewusstseinsveränderung im Kopf. …
Text
Michael Obrist
“Von göttlichen Augen und menschlichem Irren. Raumphänomene in Zeiten von Google Earth.”
In:
“food&grid. raum&designstrategien”
(Hrsg. Elsa Prochazka)
2009
Als Steward Brand, der später als Initiator und Herausgeber des „Whole Earth Catalogue“ nicht nur in der amerikanischen Gegenkultur zu großer Berühmtheit gelangte (Steve Jobs bezeichnete den Katalog als „Bibel seiner Generation“ und Vorläufer von Google im Paperback-Format), im Jahre 1966 Ansteck-Buttons mit der Aufschrift: „Why haven‘t we seen a photograph of the whole Earth yet?!“ produzierte und neben dem Verkauf derselben auch einen Teil davon an die Senatoren und wichtigsten Institutionen Amerikas und der damaligen Sowjetunion schickte, hatte er nichts geringeres als den Versuch einer globalen Bewusstseinsveränderung im Kopf. …
Text
Michael Obrist
“Von göttlichen Augen und menschlichem Irren. Raumphänomene in Zeiten von Google Earth.”
In:
“food&grid. raum&designstrategien”
(Hrsg. Elsa Prochazka)
2009